Die Groteske und ihr Schräges
Von Heiko Arntz
Vorwort zum Nachwort
1997 erschien im Reclam Verlag eine von mir zusammengestellte Anthologie mit «Grotesken aus zwei Jahrhunderten» unter dem Titel ‹Schräge Geschichten›. Knapp zehn Jahre später erschien die kleine bunte Broschur erneut, jetzt im Hardcover unter dem Titel ‹Reisen im Karton›. Ausgangspunkt und Auslöser für die Sammlung war ein Brief von Eugen Egner aus dem Jahr 1992, dem ein Brief meinerseits vorausgegangen war, in dem ich den Autor nach seinen literarischen Vorbildern gefragt hatte. Denn Eugen Egners Werke, seine Prosa und seine Zeichnungen, beschäftigten mich sehr. Nicht nur, weil ich als sogenannter «Junglektor» des Haffmans Verlags das Vergnügen hatte, den Autor lektorierend betreuen zu dürfen. Tatsächlich war Eugen Egner für mich die dritte große literarische Entdeckung nach Arno Schmidt und Eckhard Henscheid. Entdeckung heißt: Eine ganz neue literarische Welt tat sich auf – nicht nur die literarische, die ein Autor da erschaffen hatte, sondern auch die historisch bereits vorhandene, auf die er sich bezog. Als Arno-Schmidt-Leser war ich auf diese Weise zum Christoph-Martin-Wieland-Leser geworden, zum Schnabel-, Wezel-, Moritz-Leser (wenn auch nicht zum Karl-May-Leser). Als Henscheid-Leser lernte ich kennen oder mit anderen Augen sehen: Dostojewski, Svevo, Eichendorff, Gottfried Keller, Ror Wolf und Brigitte Kronauer. Sowohl Schmidt als auch Henscheid haben ausdrücklich auf diese Vorbilder hingewiesen. Henscheid etwa in seinem Beitrag zu der FTB-Reihe ‹Mein Lesebuch›, Schmidt in seinen zahlreichen (Rundfunk-)Essays, und wenn Henscheid sich zu Keller äußert oder Schmidt zu den Schwestern Brontë, erfährt man natürlich vor allem etwas über Henscheid und über Schmidt. Ähnliches erhoffte ich mir von Eugen Egner.
Nach seinen literarischen Vorbildern befragt, antwortete er mir am 31. 3. 1992 wie folgt:
Von einer Liste meiner literarischen Appetitanreger, Wachstumsförderer und Wunderdrogen war die Rede. Gern will ich versuchen, sie alle möglichst vollzählig herzuerzählen, was aber auch ein wenig Glückssache ist; manchmal vergesse ich ganz Wichtiges. Hoffen wir also das Beste und beginnen (rein ab bis auf den Grund – oder wie sagt man da? –) ohne Forcht & Scheu:
Also, alles begann mit den Bildern von Carl Barks & denen anderer Disney-Zeichner. Daher kam meine erste große Literaturhauptbeeinflussung durch Frau Erika Fuchs. Das haben wir ja schon festgestellt. Ganz furchtbar wichtig war mit 14 die Entdeckung der Texte von John Lennon! Um die gleiche Zeit hörte ich auf BFBS (damals noch BFN) die Goon Show. Verstanden habe ich fast nichts, aber die Geräusche haben mich gewaltig fasziniert, was übrigens unvermindert anhält, bloß verstehe ich heute sogar gut 80 % der Texte (habe über 2 Dutzend Goon Shows auf Kassette!). Dann entdeckte ich auch bald die Dylan-Texte der sogenannten «surrealistischen» Phase (1965/66). Heute erst kann ich die richtig goutieren. Englischsprachige Musiktexte haben stets eine große Rolle bei mir gespielt, ob von Hendrix oder Procol Harum (Keith Reid!). Psychedelia blieb ja nicht ohne Einfluß und Folgen auf mein Wirken. Ab 1970 Kafka – große Begeisterung! Gleichzeitig Hoffmanns E. T. A. und etwas später Jean Paul! Mein literarisches Bewußtsein stellt ein Pendant zum vielzitierten «Asbestmagen» dar. Eine Zeit lang habe ich etliches von Thomas Mann gelesen, fürs Sprach- und Ausdrucksempfinden / -vermögen war das nicht unwesentlich. Inzwischen ist er mir aber sehr vergangen.
1977 entdeckte ich durch das Zutun meiner Musik- / Drogenkumpane den großen Kurt Kusenberg. Ein Jahr vorher hatte ich in Bernkastel-Kues beschlossen, Autor zu werden. Das nahm nun Formen an, bis 1986 habe ich aber wenig Brauchbares geschrieben. Ganz grandiose nächste Entdeckung (durch sogenannten Zufall): Bruno Schulz Anfang der 80er Jahre. Da habe ich sehr mit den Ohren geschlackert. Lewis Carroll habe ich vergessen – ebenfalls hauptwichtig! Auch ein paar Kleinigkeiten von Christian Morgenstern wollen wir nicht übergehen.
Seit 1973 bin ich mit allen objektiven Einschränkungen subjektiver Kempowski-Anhänger. In Sachen Schrecklichkeit (Humor) und Groteske sehe ich ihn als einen meiner Großmeister an. Valentin ist natürlich ebenfalls einer! Evelyn Waugh (strecken- und teilweise), ebenso Wodehouse. Donald Barthelme mindestens mit einem Text! Woody Allen unbedingt! Frühe / mittlere (bis 1976) Zappa-Texte! Die Einflüsse überschlagen sich, hinzutritt Ilse Aichinger mit ihrem ‹Besuch im Pfarrhaus› und ein paar anderen hermetischen Texten. Sehr schätze ich Herrn Nonnenmanns ‹Die sieben Briefe des Dr. Wambach› und ‹Teddy Flesh›. Na klar, von Hermann Harry Schmitz gefällt mir auch manches, von Ludwig Harig ‹Der kleine Brixius›. Flann O’Brien braucht gar nicht mehr erwähnt zu werden, da haben Sie ja bereits gewisse Eindrücke gewonnen. Kurt Vonnegut kann auch mit dem einen bzw. anderen begeistern. Jacques Roubauds ‹Schöne Hortense› habe ich gern gelesen. Früher habe ich mich, in den 70ern war’s, für die absurden Sachen von Ionesco begeistert; da kommt wohl auch einiges her bei mir. Und die klassischen Surrealisten!
Master Pepys hat mich hingerissen zu großem Beifall und eifrigem Lesen. Von Axel Marquardt gefällt mir manches, vor allem das Weltklasse-Gedicht mit der Zeile «ist mein Freunt nit mehr» oder «ist nit mehr mein Freunt» oder so ähnlich, mit ähnlicher Schreibweise und Orthographie. ‹Tynset› von Wolfgang Hildesheimer gefällt auch gar sehr.
Wen habe ich vergessen? Klar: Spike Milligan, aber den habe ich ja schon unter «Goon Show» miterwähnt; er hat die meisten geschrieben. (In dieser Abteilung: Marx Bros., W. C. Fields und Monty Python sowieso!) Dann lese ich jede Menge populärwissenschaftliche Bewußtseinserweiterungsbücher (u. a. die für Grundlagen immer wieder guten Sachen von Ditfurth, aber auch werweißwas sonst noch).
Haufenweise Biographien habe ich verschlungen, jetzt habe ich selbst eine.
Cartoons etc. nicht vergessen: Chas Addams & Edward Gorey obenan, Robert Crumb und Pardon (WimS!!!).
Karl May habe ich auch als Kind nicht lesen mögen; J. F. Cooper und Gabriel Ferry habe ich damals gemocht, heute plündere ich sie für meinen ersten Roman.
Habe ich jetzt Neugier oder Bestürzung erregt?
Soviel zu der unvollständigen Liste, die noch einige englische Erzähler umfassen müßte, aber ich bin jetzt zu faul, nachzusehen. Ach ja, ‹Hinkepott› von Horst Janssen! Lichtenberg, soweit ich ihn begreife (habe nur Mittlere Reife!). Gogol – na klar: ‹Die Nase›, ‹Der Mantel› etc. Von D. Charms gefällt mir dies und das; die Stelle mit der verbogenen Lupe in einem Roman von Boris Vian liebe ich sehr, aber wo kämen wir hin, wenn ich jetzt noch einzelne schöne Stellen aufzählen wollte!
So in etwa müßten das mehr oder minder die Wichtigsten sein. Oh, dies noch unbedingt: Mozarts Briefe!
Wolfgang Bauers ‹Fieberkopf› war mir in den 70ern wert, zwei, drei frühe Sachen von Jonke. WÖLFLI!!! Schwitters! Ball!
Für heute mag’s genügen, schließlich schreibe ich einen Roman. Ist das nicht wundervoll?
Ich schrieb damals zurück, das sei natürlich viel Stoff. Die Auswertung der Liste werde «die Egner-Forschung noch viele Jahre beschäftigen». Eine Anspielung auf Gerhard Henschel, der ein Jahr zuvor in einem Artikel in der ‹Frankfurter Rundschau› geschrieben hatte: «Mächtig schreitet die Egner-Forschung voran! Und die Abhängigkeit nimmt zu!» Seinen Artikel eröffnete er mit den Worten: «Im Sommer 1988 erschien in der Literaturzeitschrift ‹Der Rabe› eine kleine Bildergeschichte zum Thema Junggesellenjahre von Eugen Egner, und mit dieser Einstiegsdroge begann meine Laufbahn als Egnerianer. Bis heute hat die Geschichte, mit der alles anfing, nichts von ihrem magischen Naturalismus, ihrer Komik und ihrem subtilen Pathos eingebüßt.» Gerhard Henschel spürte in seinem großen Porträt einer Faszination nach, die auch mich ergriffen hatte, und der Begriff der «Forschung» war nicht nur ironisch gemeint, sondern bezeichnete eine richtige Herangehens- und Umgangsweise mit lebendiger Literatur. Als Eugen-Egner-Leser betrat man wie ein Forschungsreisender eine neue, unbekannte, schwer durchschaubare, komisch-magische Welt. Und zurückgekehrt versuchte man den Daheimgebliebenen möglichst genauen Bericht zu erstatten. Es ging darum, «Landschaften zu durchstreifen, in ihre abgelegensten Winkel zu dringen, Schluchten auszuloten, Korn für den Speicher zu holen» (um eine Formulierung von Robert Minder zu zitieren), und nicht um die Ermittlung eines «Sinns», denn was wäre der «Sinn» einer Landschaft?
Knapp drei Jahre hat mich die «Auswertung» der Liste beschäftigt. Sie zeitigte 1996 ein erstes Resultat in Form eines kleinen Vortrags zum Wesen der literarischen Groteske (‹Wunderbar komisch›) und ein weiteres im Jahr darauf in besagter Anthologie, wo sich nicht nur viele der von Eugen Egner genannten Autoren wiederfanden, sondern auch Eugen Egner selbst mit drei Texten besonders prominent vertreten war. Schließlich war und ist er (in meinen Augen; und ich habe nun mal keine anderen) der wichtigste Vertreter dieser sonderbaren, phantastischen Gattung, nicht nur im deutschsprachigen Raum.
Im Nachwort versuchte ich, ähnlich wie in dem Vortrag, anhand der anthologisierten Autoren, das Wesen der bis dato in der sog. Literaturwissenschaft nur unzureichend beschriebenen Erzählform zu erfassen. (Als Standardwerk galt in der Germanistik Wolfgang Kaysers ‹Das Groteske: Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung›, ein entsetzlich ahnungsloses Werk, das dem Grotesken tatsächlich den Sinn zuschreiben will, moderne «Zerrissenheit« und «Entfremdung» zu «bedeuten». Was in etwa so klug ist wie, atonaler Musik eine «Bedeutung» unterzuschieben, statt sie als Kompositionsprinzip zu begreifen.)
Hier nun also das Nachwort. Die zitierten Seitenzahlen beziehen sich natürlich auf die Seiten im Buch; ich füge in Fußnoten an, um welche Texte es sich genau handelt. – Der Textauszug aus Hoffmanns ‹Meister Floh›, auf den mit den eröffnenden Worten verwiesen wird, stelle ich dem Ganzen zum besseren Verständnis voran:
E. T. A. Hoffmann Seltsames Beginnen reisender Gaukler
Alle Vorübergehenden blieben stehen, reckten die Hälse lang aus und kuckten durch die Fenster in die Weinstube hinein. Immer dichter wälzte sich der Haufe heran, immer ärger stieß und drängte sich alles durcheinander, immer toller wurde das Gewirre, das Gelächter, das Toben, das Jauchzen. Diesen Rumor verursachten zwei Fremde, die sich in der Weinstube eingefunden, und die, außerdem, daß ihre Gestalt, ihr Anzug, ihr ganzes Wesen etwas Fremdartiges in sich trug, das widerwärtig war und lächerlich zu gleicher Zeit, solche wunderliche Künste trieben, wie man sie noch niemals gesehen hatte. Der eine, ein alter Mensch von abscheulichem schmutzigem Ansehen, war in einen langen sehr engen Überrock von fahlschwarzem glänzendem Zeuge gekleidet. Er wußte sich bald lang und dünn zu machen, bald schrumpfte er zu einem kurzen dicken Kerl zusammen und es war seltsam, daß er sich dabei ringelte wie ein Wurm. Der andere hochfrisiert, im bunten seidnen Rock, ebensolchen Unterkleidern, großen silbernen Schnallen, einem Petit Maitre aus der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gleichend, flog dagegen ein Mal über das andere hoch hinauf an die Stubendecke und ließ sich sanft wieder herab, indem er mit heiterer Stimme mißtönende Lieder in einer gänzlich unbekannten Sprache trällerte.
Nach der Aussage des Wirts waren beide, einer kurz auf den andern als ganz vernünftige bescheidene Leute in die Stube eingetreten und hatten Wein gefordert. Dann blickten sie sich schärfer und schärfer ins Antlitz und fingen an zu diskurieren. Unerachtet ihre Sprache allen Gästen unverständlich war, so zeigte doch Ton und Gebärde, daß sie in einem Zank begriffen, der immer heftiger wurde.
Plötzlich standen sie in ihre jetzige Gestalt verwandelt da und begannen das tolle Wesen zu treiben, das immer mehr Zuschauer herbeilockte.
«Der Mensch», rief einer von den Zuschauern, «der Mensch, der so schön auf und nieder fliegt, das ist ja wohl der Uhrmacher Degen aus Wien, der die Flugmaschine erfunden hat und damit ein Mal übers andre aus der Luft hinabpurzelt auf die Nase?» – «Ach nein», erwiderte ein anderer, «das ist nicht der Vogel Degen. Eher würd ich glauben, es wäre das Schneiderlein aus Sachsenhausen, wüßt ich nicht, daß das arme Ding verbrannt ist.» –
Ich weiß nicht, ob der geneigte Leser die merkwürdige Geschichte von dem Schneiderlein aus Sachsenhausen kennt? – Hier ist sie ...
Nein, ist sie nicht, sondern hier nun endlich das –
Nachwort: Die Groteske und ihr Schräges
Durch diesen Trieb sehen wir also die zeitliche Welt auf die gewöhnliche Art, aber zugleich aus einem ganz anderen Licht, indem in ihm das Licht des Wesens und der Phantasie übergegangen ist, weshalb uns denn die Gegenstände ganz bekannt und gewohnt, aber zugleich durchaus verschoben, seltsam und schief gegeneinander gerückt erscheinen, wenn wir sie nach dem Maße der gemeinen Sittlichkeit betrachten.
K. F. W. Solger, Erwin
Ein Mißverständnis ist aufzuklären: Die beiden Herren aus E. T. A. Hoffmanns ‹Meister Floh›, deren seltsames Beginnen wir auf Seite 86 miterleben können, sind durchaus nicht die grotesken Gestalten, die sie zu sein scheinen. Tatsächlich stammen die beiden, die sich dort in jenem Weinhaus zum Gespött der Leute machen, aus dem sagenhaften Land Famagusta; es handelt sich um niemand Geringeren als um den Egelprinzen, seines Zeichens Bewohner der Schlammwasser, und um seinen Erzfeind, den Genius Thetel, der eher in den Lüften zu Hause ist; und beide hat es nun auf der Suche nach der schönen Prinzessin Gamaheh ins ganz und gar diesseitige Frankfurt am Main verschlagen. Egelprinz und Thetel in Famagusta sind durchaus keine grotesken Gestalten! Wenn der Egelprinz sich in Famagusta wie ein Wurm windet und der Genius Thetel sich in die Lüfte erhebt, provoziert das selbstverständlich kein «Gelächter», «Toben» und «Jauchzen» bei den Vorübergehenden. Dort sind sie (Schlammwasser hin, Schlammwasser her) rein phantastische Gestalten. In die Maße des Bürgerlichen gezwängt aber, erscheint das phantastische Leben dieser höheren Naturen grotesk. – Die literarische Groteske entsteht in diesem Bereich: wo die Sphäre des Phantastischen sich mit der des Realistischen überschneidet. Das Phantastische macht sich hier lächerlich, und das altvertraute Realistische erscheint nun nicht mehr recht altvertraut, sondern seine Gegenstände erscheinen «verschoben, seltsam und schief gegeneinandergerückt»[1] – mit einem Wort: schräg.
Das bedeutet andersherum: In der Welt der Groteske siedelt als das Wunderliche, Abwegige, Übertriebene im irgendwie Vertrauten, Maßvollen, bleibt all das Phantastische an Vernunft und Logik, also ans Realistische gebunden. Vor allem bleibt es ans Erzählbare gebunden und dies in ganz besonderer Weise.
Das realistische Erzählen setzt, mit Hegel zu sprechen, eine zur Prosa geordnete Welt immer schon voraus. Diese Prämisse kann der Dichter der Groteske als Sachwalter unserer höheren Natur, der Phantasie, nicht akzeptieren. Ihm geht es wie dem Woody Allen in der Pantomime-Vorstellung (S. 66), [2] der nicht verstehen kann, daß man in den Gesten des Mimen unbedingt und ausschließlich allgemein Bekanntes wiedererkennen soll, daß Phantasie also gerade fehl am Platze ist.
Für die Phantasie kann es keine bereits vorhandene Welt geben, auf die nur verwiesen werden müßte. Auf Wiedererkennbarkeit baut die Groteske nicht. Folglich wird in ihr eine Welt immer erst errichtet:
«Wir fanden es gut, Dörfer zu bauen, die an den Wald grenzten. [...] Gegen den Wald zu wurden die Häuser seltener, und es kostete Mühe, das letzte Haus das letzte sein zu lassen», lesen wir bei Ilse Aichinger (S. 15),[3] und bei Eugen Egner heißt es: «Wir leben am östlichen Rande des von Menschen besiedelten Gebietes. Weiter im Osten gibt es nur noch zwei Kirchtürme, dann nichts mehr.» (S. 11) [4]
Aus Gegenständen der uns vertrauten Welt wird da eine neue erfunden, und ihr Rand markiert, was zur grotesken Welt gehören soll und was nicht. Aber unsere Vernunft kommt darüber nicht zur Ruhe, es ist ihr unmöglich, «das letzte Haus das letzte sein zu lassen», und so verschiebt sich der Rand unablässig. Die groteske Welt ist provisorisch, und die Dinge, aus denen sie gemacht ist, neigen entschieden zur Metamorphose.
Das erste Beispiel für die Gattung Groteske ist Lewis Carrolls Roman ‹Alice im Wunderland›. Er erscheint 1865 und verdient, der erste Vertreter der Groteske als humoristisch-phantastischer Gattung genannt zu werden, da nun nicht mehr wie bei Hoffmann erst in der Überschneidung zweier ansonsten eigenständiger Reiche (also in der Kollision des phantastischen Famagusta mit dem prosaischen Frankfurt am Main im ‹Meister Floh›) Groteskes entsteht, sondern die Welt bei Carroll ist insgesamt fremd und vertraut, phantastisch und realistisch zugleich, insgesamt schräg also.
Carroll hat seine Geschichte von ‹Alice’s Adventures under Ground›, wie sie ursprünglich hieß, auf einer Bootsfahrt aus dem Stegreif entwickelt. Er beschreibt die Vorgehensweise wie folgt:
Ich hatte meine Heldin geradewegs in ein Kaninchenloch geschickt [...], ohne auch nur im mindesten zu wissen, was anschließend geschehen sollte [...]. Bei der Niederschrift fügte ich viele neue Ideen hinzu, die – wie es schien – aus dem ursprünglichen Material erwuchsen; und Jahre später kamen noch mehr hinzu, als ich es für die Veröffentlichung nochmals aufschrieb. [5]
Es ist gemeinsames Charakteristikum aller Grotesken, daß sie derart extemporierend, also mehr oder weniger ohne Vorplanung entstehen und linear, also Einfall an Einfall reihend, entwickelt werden: Franz Kafkas Romane und Erzählungen entstanden grundsätzlich so, gleiches gilt für die Erzählungen Bruno Schulz’, die Romane Boris Vians, Flann O’Briens Roman ‹Der dritte Polizist›, Wolfgang Bauers ‹Der Fieberkopf› oder etwa die Prosa Eugen Egners.
Diese Form des Gedankenspiels bewahrt die Groteske vor der Erstarrung in mythischer Abstraktion. Das Provisorische und vor allem das Metamorphische der grotesken Welt läßt ihre Helden ja zuweilen agieren wie nur je einen Sisyphos oder Tantalos. Alice findet es verständlicherweise wirklich schwer, anständig Croquet zu spielen, wenn nicht nur alle Spieler gleichzeitig spielen, anstatt zu warten, bis sie an der Reihe sind, sondern zu allem Überfluß auch noch Schläger, Kugeln und Tore fortwährend ihre Position und sogar ihre Gestalt verändern (S. 62). Das Linear-Extemporierende der grotesken Phantasie, das für das Metamorphische, das nie zur Ruhe Kommende verantwortlich ist, erweist sich aber zugleich als das Rettende: Der Leser kann gewiß sein, daß im nächsten Moment einfach ein ganz anderes Spiel gespielt wird. Und dann wieder was ganz anderes geschieht. Und immer so weiter. Die Groteske ist, wie Kafka von seinem Amerika-Roman sagte: ins Endlose angelegt.
Worauf läuft so etwas aber hinaus? Wie endet ein solches extemporierendes, lineares Erzählen, das ja gerade keinen Stillstand, kein Ende duldet? – Mehr oder weniger gewaltsam. Wir befinden uns ohnehin im Zuständigkeitsbereich der Komödie mit ihrer «Liebe zum leersten Ausgang» (Jean Paul); in der Groteske aber ist der eigentliche Schluß in ganz besonderer Weise unwichtig. Alice, die ihre Abenteuer im Traum erlebt, muß früher oder später natürlich aufwachen. Die Helden bei Franz Kafka oder Boris Vian werden mal mehr, mal weniger sanft irgendwann beiseite geschoben, und bei Ror Wolf erleben wir regelmäßig, wie die Requisite, aus der die groteske Welt gemacht ist, gleichsam noch während der Vorführung wieder abgeräumt wird, so daß da «gar nichts mehr» ist, «kein Mensch, keine Straße, kein Regen, keine Füße; also nichts von den Dingen, von denen wir glauben, daß es sie tatsächlich gibt». (S. 31) [6] In einer Geschichte Eugen Egners heißt es: «Ich aber bin noch alt geworden und dann irgendwo gestorben.» [7] Ende des Gedankenspiels.
Für Friedrich Schlegel und die Frühromantik war die Groteske (oder die «Arabeske») «die älteste und ursprünglichste Form der menschlichen Phantasie. [...] Denn«, so führt Schlegel im ‹Gespräch über die Poesie› fort, «das ist der Anfang aller Poesie, den Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzuheben und uns wieder in die schöne Verwirrung der Phantasie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versetzen [...].»[8]
Die Verwirrung in der Groteske ist vollkommen, da Gang und Gesetze unserer Vernunft nicht einfach durch Absurdes, Surreales, Märchenhaftes oder durch eine andere Gestaltungsweise des rein Phantastischen abgelöst werden. Die Groteske erfindet eine Welt, in der das gewöhnliche Leben, die zeitliche, räumliche Welt, konkret und im Detail von dem ergriffen wird, was von Haus aus ohne Zeit und Raum, also maßlos ist – der Phantasie. In einem der Prosafragmente Kafkas (S. 44) [9] läßt diese Phantasie die Zeit derart stillstehen, daß ein Hund, ein Reiter, ein kleines Mädchen mit ihren Gänsen, ein Schwimmer gar und wer nicht noch alles – obwohl ein jedes mit seiner Geschwindigkeit reist! – sich nicht gegenseitig überholen können. Und in dieses Bild platzt nun der Kurier des Zaren und beschwert sich, daß alles «so widerwärtig langsam» geht. Genau – so denkt die Vernunft in der Groteske: Wenn Zeit und damit die Bewegung auch eine Illusion ist, so ist das noch lange kein Grund zum Trödeln!
Erst die paradoxe Gleichzeitigkeit von Phantastischem und Realistischem macht die Verwirrung der Groteske so vollkommen, daß sie schön genannt zu werden verdient; ihre Komik resultiert aus der Anschauung ebendieses unlösbaren Widerspruchs.
Was Heinrich Heine über Hoffmanns «Capriccio» ‹Prinzessin Brambilla› sagt, gilt daher für die literarische Groteske insgesamt und trifft ihr Wesen: «Wem diese durch ihre Wunderlichkeit nicht den Kopf schwindelig macht, der hat gar keinen Kopf.»[10]¶
‹«Nachwort» erschienen in: Schräge Geschichten. Grotesken aus zwei Jahrhunderten. Hg. von Heiko Arntz, Stuttgart: Reclam 1997; Neuausgabe als: Reisen im Karton. Schräge Geschichten, Stuttgart: Reclam 2006.›
[1] K. F. W. Solger, Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst, Berlin 1815, zit. nach: Wolfgang Preisendanz, Humor als dichterische Einbildungskraft, München 1963, S. 70.
[2] Ein bißchen lauter, bitte!, in: Das Woody Allen Buch, Hamburg: Rogner & Bernhard 1994.
[3] Das Bauen von Dörfern, in: I. A., Eliza Eliza. Erzählungen (1958–1968), Frankfurt a. M.: FTB 1991.
[4] Das Erlebnis, in: E. E., Als der Weihnachtsmann eine Frau war und andere erstaunliche Geschichten, Zürich: Haffmans 1992.
[5] In: The Theatre, April 1887, zit. nach: L. Carroll, Alice im Wunderland. Alice im Spiegelland, Leipzig: Reclam 1990, S. 261.
[6] Der Wind, der Regen oder irgend etwas, in: R. W., Nachrichten aus der bewohnten Welt, Frankfurt a. M., FVA 1991.
[7] E. E., Getaufte Hausschuhe und Katzen mit Blumenmuster. Kurze Texte, Leipzig: Reclam 1996.
[8] F. S., Kritische und theoretische Schriften, Stuttgart: Reclam 1978, S. 195.
[9] F. K., Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß, Frankfurt a. M.: FTB 1983, S. 259f.
[10] Zit. nach: E. T. A. H., Späte Werke, München: Winkler 1965, S. 870.
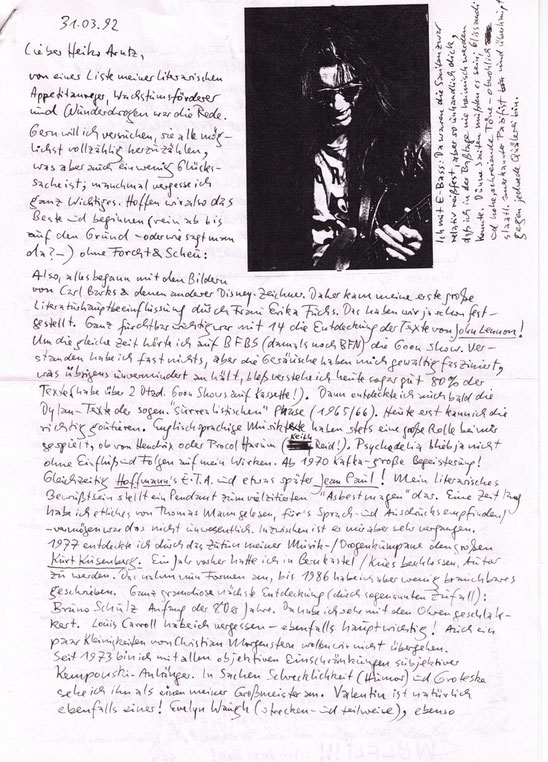
Zeugnis aus der Brief-Ära: Eugen Egner an den Lektor, samt Selbstbildnis m. Baßgitarre
